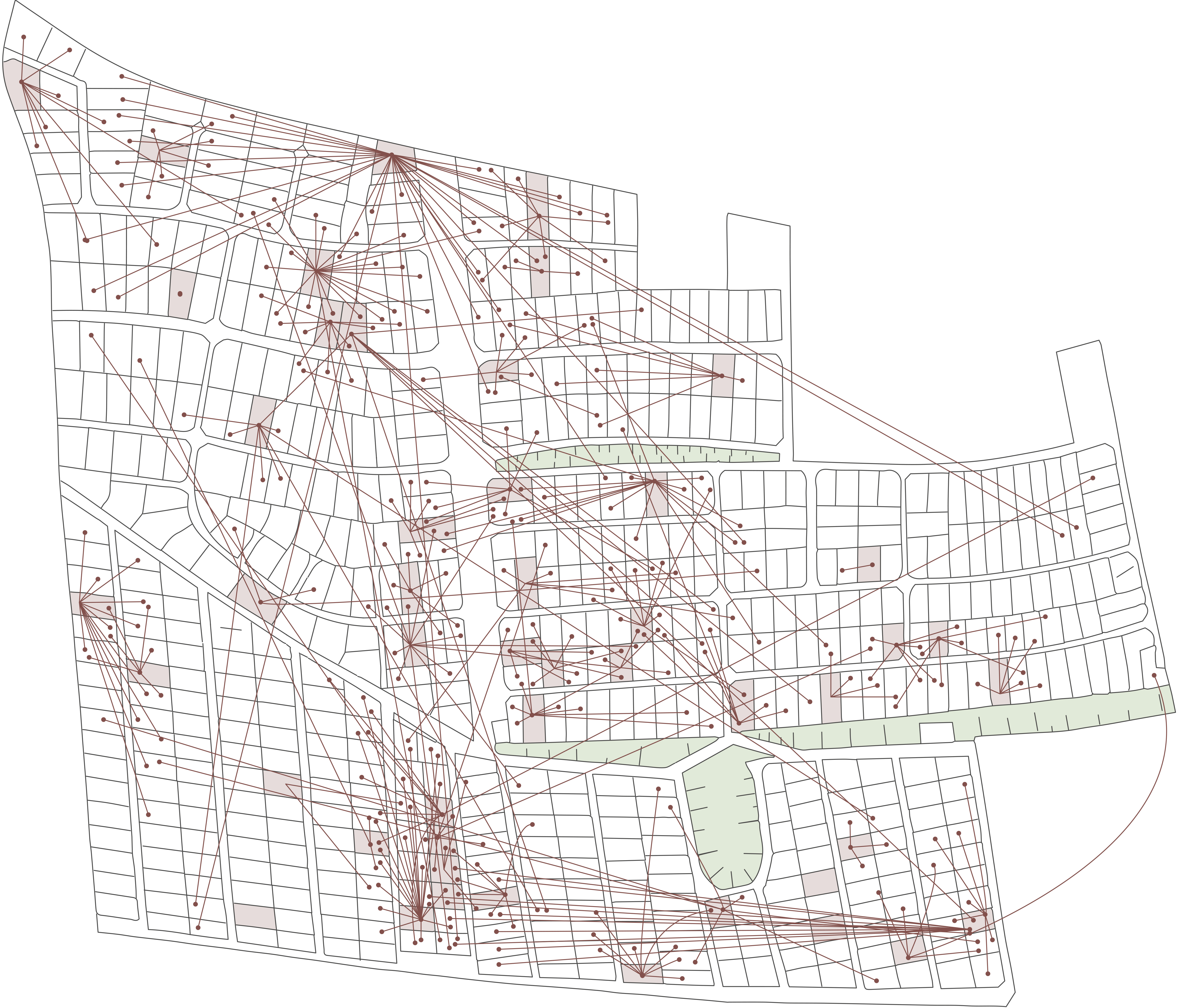Wiener Kleingärten blicken auf eine über hundertjährige Geschichte zurück. Ursprünglich zur Selbstversorgung und Erholung oder aufgrund von Wohnungsnot entstanden, entwickelten sie sich zu temporären Sommerdomizilen mit klaren gesetzlichen Vorgaben. In den 1990er-Jahren markierte eine rechtliche Änderung einen Wendepunkt: Das ganzjährige Wohnen wurde erlaubt und Parzellen konnten erworben werden. Diese Entwicklung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die soziale Struktur der Kleingartenanlagen. Permanente Nutzung fördert häufigere Begegnungen – etwa am Gartenzaun oder bei alltäglichen Aufgaben – und stärkt informelle Netzwerke, die besonders für ältere Menschen wichtig sind. Gleichzeitig entstehen neue Herausforderungen: Enge Nachbarschaft, unterschiedliche Lebensstile und Generationenkonflikte können zu Spannungen führen. Die Eigentumsübertragung einzelner Parzellen hat das soziale Gefüge bislang kaum verändert, doch bei Weiterverkäufen oder Neuvermietungen, insbesondere bei steigenden Preisen und abnehmender sozialer Durchmischung, kann der Zusammenhalt gefährdet sein. Der Verkaufsstopp 2021 war daher ein wichtiger Schritt zur Sicherung dieser Vielfalt. Für ein gutes Miteinander sind vier Hauptakteur_innen entscheidend: die Kleingärtner_innen, die Vereinsleitungen, der Zentralverband und die Stadt Wien. Letztere ist gefordert, Kleingärten stärker in stadtplanerische Überlegungen einzubeziehen. Kleingartenanlagen sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern bieten Potenzial für lebendige Nachbarschaften in einer zunehmend anonymen Stadt und können Modellräume für soziale Resilienz sein – wenn ihr Wert als Gemeinschaftsort erkannt und unterstützt wird.Alle hier hochgeladenen Inhalte sind das eigene Werk der Absolventin oder des Absolventen.