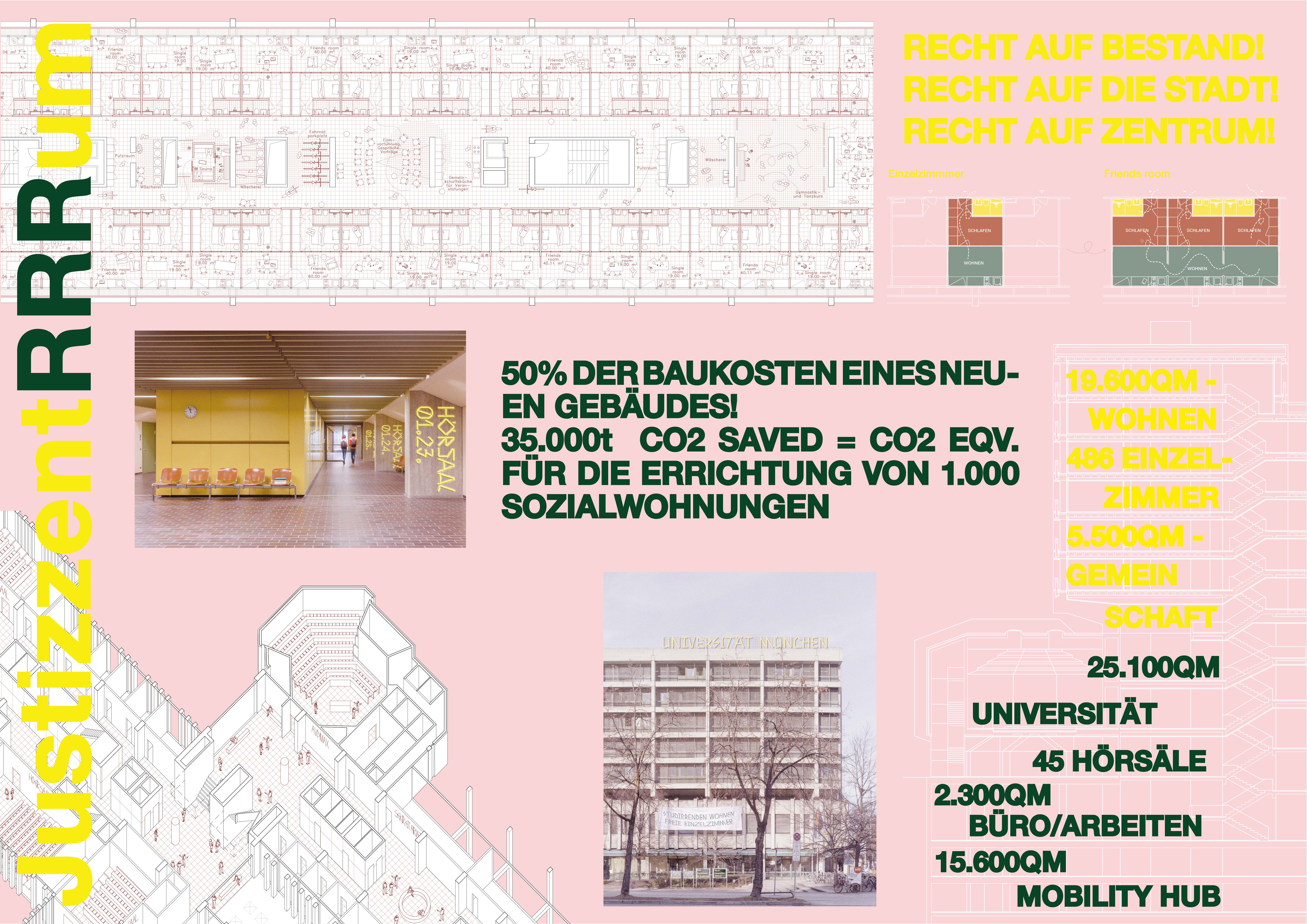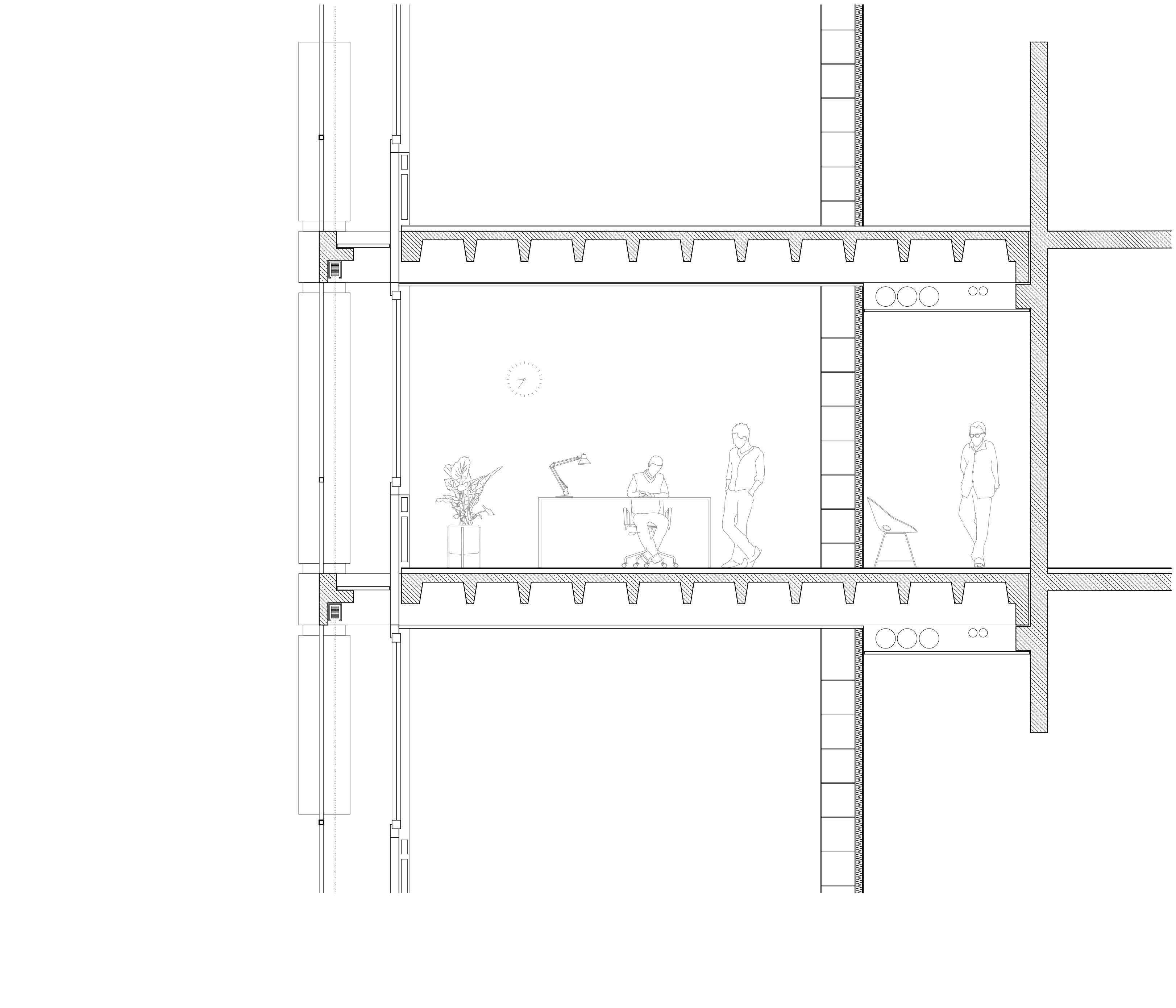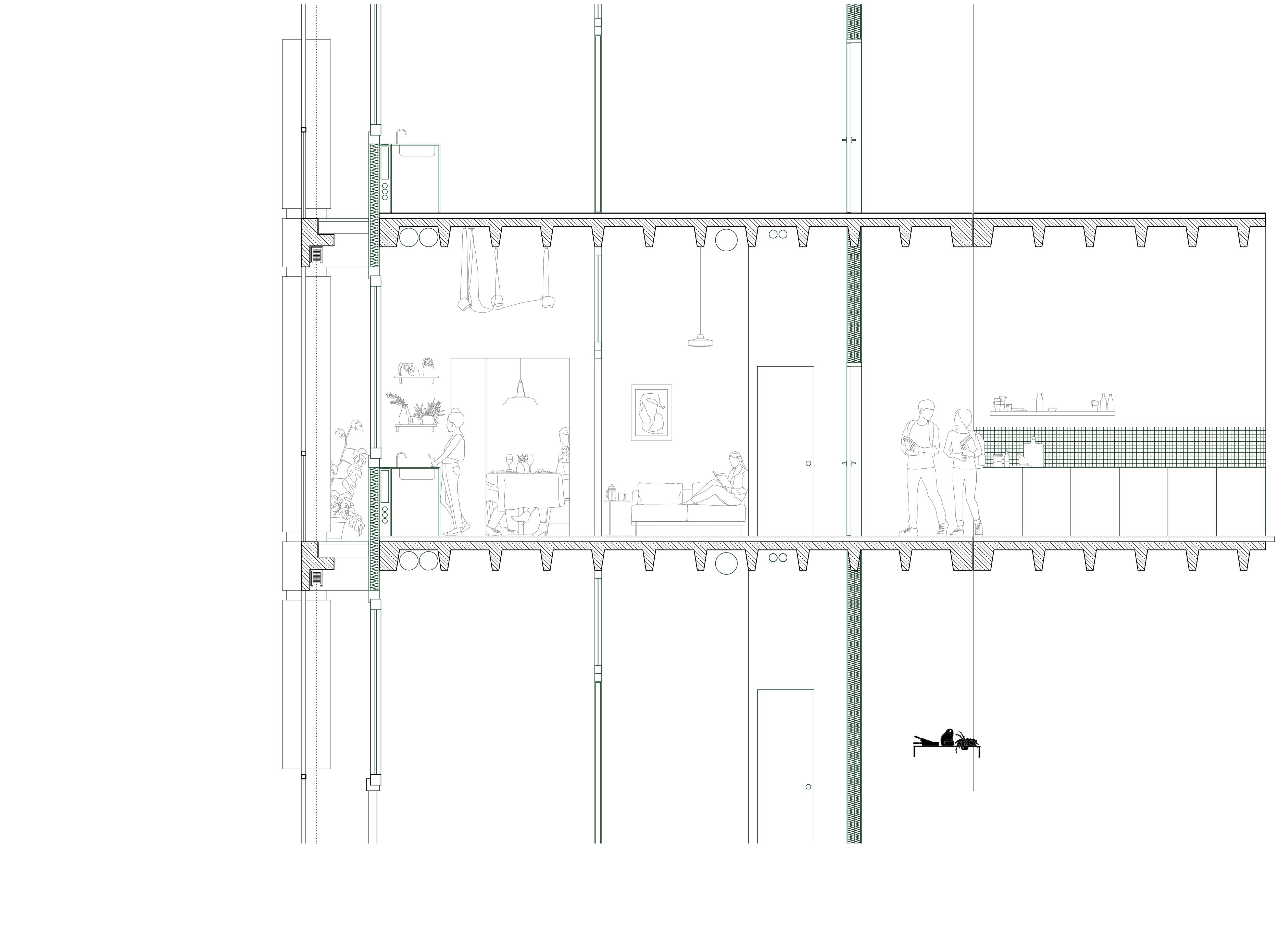Um die drohende globale Klimakatastrophe zu verhindern, müssen gewohnte Denk- und Verhaltensmuster, welche in Bezug zu Emissionen und endlichen Ressourcen stehen, geändert oder vollständig überwunden werden. Der Bausektor bildet hier einen wirkmächtigen Hebel, da er mit seinen hohen Abfallmengen und Emissionen einen erheblichen Beitrag zur beschriebenen Problematik leistet. Aus dieser Erkenntnis heraus fordern zahlreiche Expert_innen eine „Bauwende“ – einen fundamentalen systemischen Wandel unseres Verständnisses von Bauen. Der Bauwende kann aus verschiedenen Haltungen und Positionen heraus begegnet werden, doch besteht Konsens darin, dass die Erhaltung und Wiederverwendung bestehender Strukturen wesentliche Schritte hin zu einer klimaverträglichen Baukultur sind. Dieses Umdenken muss jedoch gesamtgesellschaftlich stattfinden, um seine volle Wirkung zu entfalten, ist jedoch stark von politischen Entscheidungsträger_innen abhängig. Diese setzen die dringend notwendigen Maßnahmen für die Bauwende bislang nur langsam um: Abrisse bestehender Strukturen und ressourcenintensive Neubauten bleiben in der Gegenwart weiterhin die vorherrschende Strategie des Bau- und Immobiliensektors. Dieser Umstand mobilisiert zunehmend Akteur_innen aus der Zivilgesellschaft, die den Entscheidungsträger_innen der öffentlichen Hand mit konkreten Forderungen und Vorschlägen gegenübertreten und so auf deren Versäumnisse und die daraus resultierenden Konsequenzen aufmerksam machen. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem Aktivismus: Sie untersucht das zivilgesellschaftliche Engagement dieser Akteur_innen sowie die Mittel, mit denen sie Einfluss auf Entscheidungsträger_innen der öffentlichen Hand nehmen.Alle hier hochgeladenen Inhalte sind das eigene Werk der Absolventin oder des Absolventen.